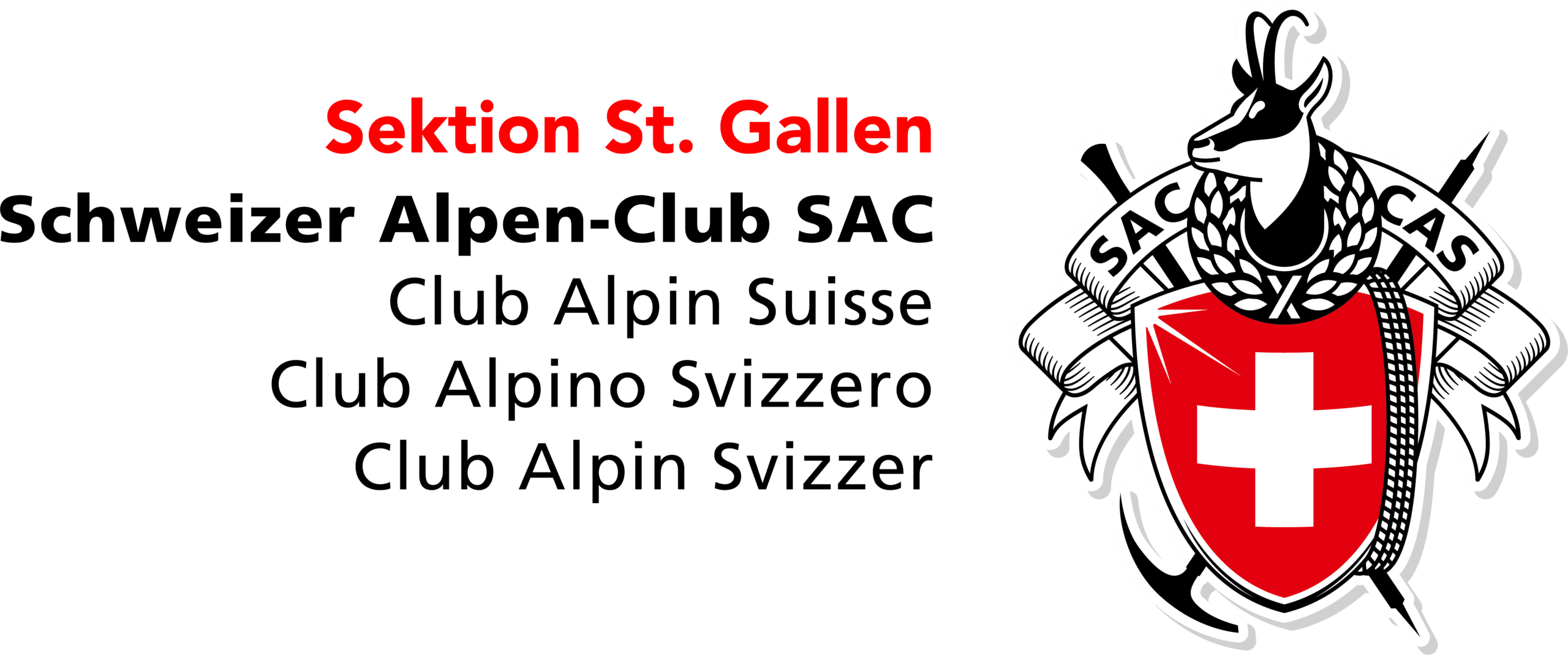Es ging durch diverse Medien und wurde breit kommentiert: ein zweiter Nationalpark ist in der Schweiz nicht zustande gekommen und wird es wohl in absehbarer Zukunft auch nicht. Meiner Meinung nach wurden viele Chancen der regionalen Entwicklung vertan.
Wenn man sich mit den Thema Schutzgebiete in der Schweiz differenzierter auseinandersetzt, so merkt man schnell, dass die Situation gar nicht so schlecht ist. Bedenkt man zum Beispiel die Bundesinventare der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) so ist bereits etwa ein Fünftel der Landesfläche dank Schutzzielen weitgehend geschützt. In diesen Gebieten dürfen neue Anlagen zur Energieproduktion nur entstehen, wenn nationale Interessen vorliegen. Und selbst dann ist der Prozess nicht einfach. Dennoch kann in diesen Gebieten zum Beispiel intensive Landwirtschaft betrieben werden.
Zudem gibt es diverse regionale Naturpärke, welche sowohl die Wirtschaft, als auch die Natur fördern sollen. Weiter gibt es ursprüngliche, naturnahe Gebiete wie Kernlebensräume und Schongebiete, Wildruhezonen und Wildschutzgebiete sowie diverse geschützte Lebensräume in der Kulturlandschaft.
All diese Gebiete haben gemeinsam, dass sie den integrativen Ansatz des Naturschutzes verfolgen. Das Ziel des integrativen Ansatzes ist es, dass in unserem Umfeld und unseren Tätigkeiten Platz für die Natur vorhanden ist und dass folglich auf der ganzen Landesfläche Naturschutz betrieben wird. Die Art und die Intensität der menschlichen Nutzung soll hier geregelt werden. Dieser Ansatz ist, meiner Meinung nach, sehr wichtig und fördert das Verständnis für die Natur.
Dem integrativen Ansatz gegenüber steht der segregative Ansatz. Hier sollen Schutzgebiete von der Nutzfläche getrennt werden und nur sehr beschränkt für Personen zugänglich sein. Der Nationalpark und viele Biotope von nationaler Bedeutung sind solche Beispiele. Ein geschicktes Besuchermanagement ist hier zentral. Aber auch kleinere Naturschutzgebiete oder bestimmte (Kern-)Gebiete von Wildruhezonen und Jagdbanngebieten verfolgen diese Idee. Dieser Ansatz ist besonders für störungsempfindliche Arten, wie z.B. das Birkhuhn, von grosser Bedeutung.
Arten, die sich nicht oder kaum an das Zusammenleben mit Menschen anpassen können, benötigen während dem Winter und der Fortpflanzungszeit ruhige, grosse und zusammenhängende Gebiete, die keine menschliche Nutzung aufweisen.
Ich denke daher, dass die Frage nicht die ist, ob wir eine ökologischere Landwirtschaft oder einen neuen Nationalpark wollen. Ich meine, nur wenn wir den integrativen und den segregativen Ansatz zu gleichen Teilen verfolgen, kann die ausgesprochene Artenvielfalt der Schweiz auf dem Niveau erhalten bleiben, dass wir alle auf unseren Touren kennen und schätzen gelernt haben.
Adrian Hochreutener, Umweltbeauftragter
adrian_hochreutener@hotmail.com
01